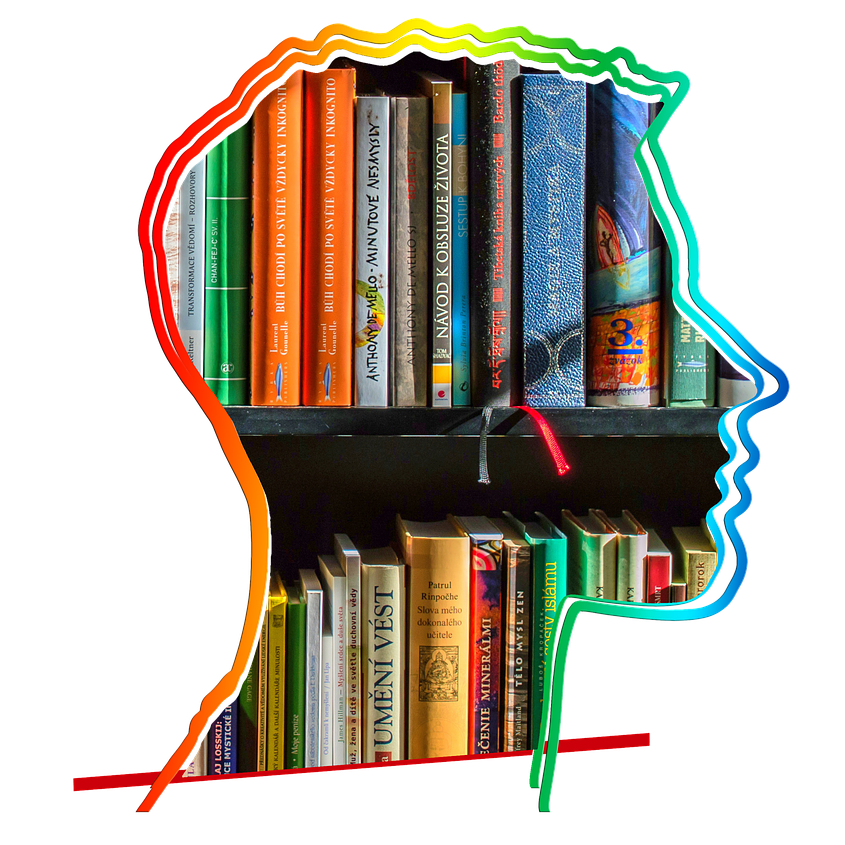Medien sind “materielle oder energetische (elektrische, elektronische, optielektronische) Träger und Übermittler von Daten und Informationseinheiten” (Hiebel, 1997, 8).
“In der ursprünglichen Wortbedeutung meint ‘Medium’ die Mitte bzw. ‘das in der Mitte befindliche’, aber auch ‘vermittelnd” (Gysbers, 2008, 29). Obgleich in den Medien– und Kommunikationswissenschaften Uneinigkeit über die Definition von Medien herrscht (vgl. ebd., 30), haben die meisten Definitionsansätze eine Gemeinsamkeit: Laut diesen vermitteln Medien kommunikative Botschaften und erschaffen neue Möglichkeiten der Kommunikation (vgl. Moser, 2019, 1f.).
Umgangssprachlich ist der Begriff “Medien” vor allem mit den Massenmedien Zeitung, Zeitschrift, Hörfunk, Fernsehen und Internet verbunden (vgl. Gysbers, 2008, 30). Massenmedien unterscheiden sich von gewöhnlichen Medien durch ihre Zielgruppe: Die Botschaften von Massenmedien richten sich häufig an kein differenziertes Publikum, wie es bei gewöhnlichen Medien der Fall ist, sondern an eine abstrakte Menge an Medienkonsumenten, die ‘Masse’ (vgl. Schanze, 2002, 200).
Eine wichtige Kategorisierung in den Medienwissenschaften wurde von Pross vorgeschlagen (vgl. Pross, 1972, 127ff.). Hierbei handelt es sich um eine Unterscheidung nach technischem Ausmaß der Mediennutzung.
- Primäre Medien sind an Elementarformen des menschlichen Körpers (Sprache, Gestik, Mimik) gebunden und beanspruchen keine zusätzlichen Geräte.
- Sekundäre Mediensind “solche Kommunikationsmittel, die eine Botschaft zu [den] Empfänger[:innen] transportieren, ohne dass [sie] ein Gerät benötig[en], um die Bedeutung aufnehmen zu können, also Bild, Schrift, Druck, Graphik, Fotographie […]” (ebd., 128).
- Tertiäre Medien benötigen sowohl bei den Produzenten als auch bei den Rezipienten ein technisches Endgerät für die Nutzung (z.B. Schallplatte, Telefon, Film, Fernsehen, Radio).
Saxer (1998, 54f.) unterscheidet Medien hingegen nach ihrer Aufgabe:
- Auf dem Mikrolevel werden Medien als (technische) Kommunikationskanäle verstanden, die dazu “geeignet [sind], unterschiedliche Zeichensysteme (visuelle, auditive, audiovisuelle) mit unterschiedlicher Kapazität zu transportieren” (ebd., 54).
- Auf dem Mesolevel werden Medien als (komplexe) Organisationen, also arbeitsteilig organisierte Produktions- und Distributionsstätten, betrachtet.
- Auf dem Makrolevel werden Medien als Institutionen, also Normen- und Regelsysteme zur Stabilisierung moderner Gesellschaften, definiert.
Aus mediendidaktischer (Verlinkung) bzw. medienpädagogischer Sicht sind Medien spezifisch organisierte Kommunikationskanäle, welche als Vermittler des Wissens- und Erfahrungstransfers agieren und den Informationsfluss im didaktischen Dreieck von Lehrenden, Lernenden und den Lerninhalten organisieren (vgl. Schanze, 2002, 233). Sowohl analoge als auch digitale, anders genannt “Neue Medien”, spielen eine wichtige Rolle in der Unterrichtsgestaltung. Medien nehmen im Unterricht eine veranschaulichende Funktion ein und tragen dazu bei, dass Schüler:innen realitätsabbildende Vorstellungen lernen (vgl. Kron & Sofos, 2003, 124). Im Unterricht besitzen Medien eine lernmotivierende Funktion, da sie Neugier und Konzentration der Schüler:innen steigern und eine abwechslungsreiche Auseinandersetzung mit den Lerninhalten ermöglichen (vgl. ebd., 132).
Kron und Sofos (2003, 124) schlagen fünf Darstellungsformen von Medien in Lehr- und Lernprozessen vor:
- “Reale Darstellung: Unmittelbare Erfahrung durch Beobachten und Handeln in organisierten Lernarrangements, z.B. in einem Labor.
- Modellhafte Darstellung: Vermittelte Erfahrung durch Nachbildungen der Realität in Modellen.
- Bildhafte Darstellung: Vermittelte Erfahrung durch Abbildungen von Gegenständen oder Sachverhalten.
- Symbolische Darstellung: Vermittelte Erfahrung durch Schemata, die komplexe Sachverhalte auf wenige wichtige Merkmale reduzieren.
- Bewegte Darstellung: Vermittelte Erfahrung durch Animationen und Videosequenzen, die Sachverhalte im Hinblick auf ausgewählte Aspekte erläutern.” (ebd., 124)
Gysbers, A. (2008). Lehrer, Medien, Kompetenz. Eine empirische Untersuchung zur medienpädagogischen Kompetenz und Performanz niedersächsischer Lehrkräfte. Schriftenreihe der NLM, 22. Niedersächsische Landesmedienanstalt für Privaten Rundfunk (Hannover). Berlin: Vistas.
Hiebel, H. (1997). Kleine Medienchronik. Von den ersten Schriftzeichen zum Mikrochip. München: Beck.
Kron, F. W. & Sofos, A. (2003). Mediendidaktik: Neue Medien in Lehr- und Lernprozessen. UTB GmbH.
Moser, H. (2019). Einführung in die Medienpädagogik: Aufwachsen im digitalen Zeitalter (6. Aufl.). Springer VS.
Pross, H. (1972). Medienforschung. Film – Funk – Presse – Fernsehen. Darmstadt: Habel.
Saxer, U. (1998). Mediengesellschaft: Verständnisse und Mißverständnisse. In: Sarcinelli, U. (eds) Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, vol 352. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-87320-0_3
Schanze, H. (2002). Lexikon Medientheorie und Medienwissenschaft: Ansätze – Personen – Grundbegriffe. J.B. Metzler.
Härtel, M., Brüggemann, M., Sander, M., Breiter, A., Howe, F. & Kupfer, F. (2018). Digitale Medien in der betrieblichen Berufsbildung: Medienaneignung und Mediennutzung in der Alltagspraxis von betrieblichem Ausbildungspersonal (Wissenschaftliche Diskussionspapiere). Verlag Barbara Budrich.
Typologien der Medien – GIB – Glossar der Bildphilosophie. (o. D.). Abgerufen von https://www.gib.uni-tuebingen.de/netzwerk/glossar/index.php?title=Typologien_der_Medien am 03.12.2022.